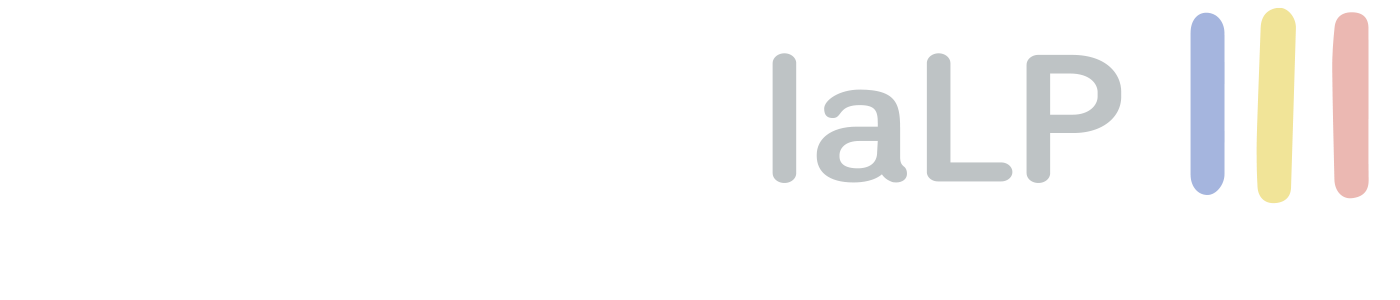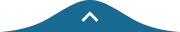Rückblick vom 26. September 2020
5. NÜRNBERGER SYMPOSIUM
FÜR LYMPHOLOGIE UND PHLEBOLOGIE
Zum fünften Mal fand im September 2020 das Nürnberger Symposium für Lymphologie und Phlebologie statt. Angesichts der Corona-Pandemie zum ersten Mal als Hybridveranstaltung mit einer eingeschränkten Präsenz im Auditorium, jedoch der Möglichkeit per Livestream teilzunehmen. Gleiches galt ebenso für die Referenten, von denen einige live über das Internet ihren Vortrag hielten. Der wissenschaftliche Leiter des Symposiums Dr. med. Michael Kraus aus Fürth ging in seiner Begrüßung der Teilnehmer darauf ein, dass mit dem Covid-19-Virus die Distanzierung zwischen den Menschen zugenommen hat. Das habe gezeigt, wie wichtig doch der persönliche Kontakt, die Nähe und Empathie im täglichen Umgang miteinander sind. Gerade beim Stellen einer gesicherten Diagnose bei Lymph- und Lipödem-Patienten sind sich alle Referenten einig, dass ein schneller Blick nicht ausreicht, sondern eine eingehende Anamnese, Zeit für ein ausführliches Gespräch, Empathie und das „Anfassen“ der betroffenen Körperteile zwingend notwendig sind.
Vorträge des 5. Symposiums
Herausforderung der Heil- und Hilfsmittelbranchen
Ein grundlegendes Problem und dringenden Handlungsbedarf sieht der Referent Dr. Roy Kühne als Mitglied des Gesundheitsausschusses des Bundestages darin, dass die laufenden (zu langen) Zulassungsprozesse für Heil- und Hilfsmittel mit dem Innovationsfortschritt oftmals nicht mithalten können. Besonders im Bereich der Hilfsmittel sieht er in Bezug auf das HHVG (Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung) noch Arbeitsbedarf, um innovative Produkte schneller an Patienten abgeben zu können, die davon profitieren. Hier sollte die Politik neben sachlichen Gesichtspunkten ebenso praktische mit einfließen lassen, beispielsweise Therapeuten und Fachpflegekräfte entsprechend zu befähigen mit Blick auf Verordnungs- und Genehmigungsgrenzen, um gerade auch im ländlichen Raum eine schnelle und qualitativ hochwertige Versorgung garantieren zu können. Grundsätzlich sollte das Bestmögliche für den Patienten und nicht für den Kostenträger oder Leistungserbringer im Fokus stehen!
Das Phlebologische Ulkus
Prof. Dr. med. habil. Michael Jünger, der Leiter der Dermatologischen Klinik Greifswald, sprach über das phlebologische Ulkus und dessen Behandlungsmöglichkeiten im klinischen Alltag. Das häufige klinische Bild bei Ulcus cruris infolge einer venösen Stauung sind: Hyperpigmentierung der Haut, Atrophie blanche oder Dermatoliposklerose. Ist das Bild untypisch, empfiehlt er Differentialdiagnosen, denn die meisten Patienten haben eine Mischung komplexer Erkrankungsursachen. Daher bedarf es eines multimodalen Therapiekonzepts. Beispielsweise kann bei einer chronisch venösen Insuffizienz der ursächliche Reflux mit Kompression behandelt werden. Dabei betont er, dass im Falle von vorliegenden Ulzera immer auch die Hautdurchblutung (nutritive Hautkapillare) betroffen ist – man spricht von kapillärer Hypertonie. Doch dank der hämodynamischen Wirkung der Kompression fällt der Kapillardruck wieder in den Normbereich ab. Zusätzlich sollte begleitend eine sinnvolle Physiotherapie und Gefäßsport erfolgen, um das Sprunggelenk wieder zu mobilisieren und die Wadenmuskel-pumpe zu reaktivieren. Venöse Ulzera heilen dann nach sechs Monaten ab. Der Sport fördert positiv den Therapieerfolg und bei kontinuierlichem Betreiben bleiben Rezidive aus. Allerdings bleibt der Effekt nur bei dauerhaften sportlichen Aktivitäten erhalten.
Endovaskulärer Verschluss der Stammvene
Der niedergelassene Gefäßchirurg und Mitbegründer des Symposiums Dr. med. Peter Heilberger aus Nürnberg gab in seinem Vortrag einen Überblick zu den chirurgischen Verfahren bei Venenleiden. Mit der Farbdopplersonografie kann der Behandler genau sehen, wo die Krampfader herkommt, wohin sie geht und wo die Insuffizienzpunkte unterbrochen werden müssen. Neben den offenen OP-Verfahren haben sich die thermischen und chemischen Verfahren etabliert. Bei den thermischen Verfahren wird mit einem Laser oder der Radiofrequenztherapie die Vene durch Wärme verschlossen. Sie zieht sich zusammen und löst sich im Nachgang auf. Allerdings muss der Operateur die Vene ultraschallgestützt punktieren und den Laser bzw. die Sonde gut zurückführen. Bei den chemischen Verfahren führt die Schaumverödung (Echosklerosierung) seit zehn bis 15 Jahren einen Siegeszug. Hierbei wird Schaum injiziert, um die Venenwand so zu reizen, dass sie sich verschließt und sich im Nachgang auflöst. Während bei der Venenverklebung die Vene mehrfach punktiert und Kleber eingespritzt wird. Die Venenverklebung ist für Dr. Heilberger ein sehr elegantes und damit das beste Verfahren, allerdings noch sehr teuer. Als Standard-Methode besonders bei Lymphödem, Lipödem und Adipositas mit harten Indikationen, wie z.B. einem (infizierten) Ulkus, empfiehlt er immer ein thermisches Verfahren nach vorheriger maximaler Entstauungstherapie. Das Schaumverfahren ist zu 70-80 Prozent effektiv, wiederholbar und weitaus günstiger und weniger aufwendig.
Das Lymphödem – Entstehung und Verlauf
Dr. med. Ulrich Eberlein betreibt eine phlebologische und lymphologische Praxis in Coburg und sprach über die Entstehung und den Verlauf des Lymphödems. Während rund ein Drittel der Betroffenen ein primäres Lymphödem aufweisen – beruhend auf einem angeborenen, genetischen Defekt (1-3 % heriditär, beim größten Teil Spontanmutation während der Embryonalentwicklung) – liegt bei zwei Drittel ein sekundäres Lymphödem vor. Dieses wird durch eine äußere Ursache ausgelöst und tritt am Ort der Schädigung auf, wobei die Leistenregion am empfindlichsten ist. Die Schädigungsursachen sind vielfältig, allerdings haben die postoperativen Lymphödeme durch verbesserte OP-Techniken abgenommen. Jetzt ist die Adipositas die Hauptursache in den Industrieländern für ein sekundäres Lymphödem. Die Fettmassen behindern mechanisch den Lymphtransport. Deshalb steht bei der Therapie die Gewichtsabnahme im Vordergrund. Therapieziel muss laut Dr. med. Eberlein sein, eine Chronifizierung und schwere Stadien zu verhindern. Denn ein unbehandeltes Lymphödem verläuft progredient – wie schnell ist dabei individuell unterschiedlich. Aber die Lebensqualität sinkt erheblich durch Schwellungen und Deformationen, rezidivierende Infektionen (Erysipele), eingeschränkte Beweglichkeit, Schwäche, Steife der betroffenen Extremitäten, psychische Effekte wie Angst und Depressionen und es besteht ein hohes Risiko für Komplikationen.
Diagnostik und Therapie des Lymphödems
Peter Nolte aus Meinerzhagen-Valbert ist niedergelassener Allgemeinmediziner mit einer festen lymphologischen Sprechstunde in der Woche. Er gab einen Einblick in seinen lymphologischen Praxisalltag mit diesen Schwerpunkten: Für eine erfolgreiche Behandlung von Lymphpatienten muss genügend Zeit eingeplant werden. Mit einer umfangreichen Textdokumentation und einer sicheren Diagnose mit sauberer Kodierung nach ICD-10 können die Fallstricke in der Verordnung z. B. bei Flachgestrick-Beantragung umgangen werden. Während der Behandlung ist die Therapieführung und Coaching durch regelmäßige Kontrolltermine wichtig, damit auch die Selbstmanagement-Maßnahmen gesichert werden. Als Ausbilder für die curriculäre Weiterbildung zum Thema Lymphologie befürwortet er die Einführung des Facharztes für Lymphologie.
Ernährungs- und Sporttherapie bei Lymphödem
Dr. oec. troph. Hans-Joachim Herrmann vom Hector-Center für Ernährung, Bewegung und Sport aus Erlangen sprach über die Ernährungs- und Sporttherapie-Möglichkeiten bei Lymphödemen. Anfangs schickte er vorweg, dass 2025 weltweit geschätzt eine Milliarde Menschen adipös sein werden. Allerdings erscheint das Lymphödem als Adipositas-assoziierte Folgeerkrankung kaum. Durch eine umfangreiche Ernährungs- und Sporttherapie muss das Übergewicht reduziert bzw. vermieden und die durch die Adipositas verursachten Entzündungen vermindert werden. Allerdings gibt es keine spezielle Diät bei einem Lymphödem. Es wird grundsätzlich eine ausgewogene Ernährung empfohlen. Da aber das Fettsäureverhältnis Entzündungen beeinflusst, kann im Körper ein Milieu geschaffen werden, dass eher pro-inflammatorisch oder anti-inflammatorisch ist. Bei Patienten mit einem sekundären Lymphödem nach Brustkrebs mit einer Axillären Lymphknoten-Dissektomie wurde ein pro-inflammatorisches Fettsäureverhältnis in den Zellen festgestellt. Damit könnte eine Omega-3-reiche (pflanzlich basiert) und Omega-6-arme (Fleisch-basiert) Ernährung ein ernährungstherapeutischer Ansatz sein. Zusätzlich zeigt eine eigene noch nicht publizierte Studie über Hochintensives Intervalltraining (HIIT) eine signifikante Verringerung des Taillenumfangs und Blutdrucks sowie eine messbare Verbesserung des Inflammationsstatus und kardiometabolischen Risikoprofils.
Das Lymphsystem und das Starlingsche Gleichgewicht
Prof. Dr. med. univ. Erich Brenner von der Universität Innsbruck erläuterte in seinem Vortrag anhand des Starlingschen Gleichgewichts den mikrovaskulären Flüssigkeitsaustausch. Denn nicht die gesamte Flüssigkeit wird von den Venen wieder zurück zum Herzen transportiert. Ein Teil der Flüssigkeit fließt ins Gewebe und von hier in die initialen Lymphgefäße, (Prä)kollektoren, Lymphstämme, dann in die Lymphknoten und Venen bzw. über die Lymphkanäle in die Venen und zurück ins Herz. Für den Erhalt des Gleichgewichtes ist das Glykokalyx-Spalt-Modell wichtig. Lange Zeit wurde die Bedeutung der Endothelzellen übersehen. Sie haben sehr schmale Zwischenräume, durch die Flüssigkeit hindurchfließen kann. Glykokalyx sind langkettige Zuckermoleküle in den Endothelzellen, die den Durchgang aller möglichen Flüssigkeiten, außer Wasser, regulieren. Im Gleichgewichtszustand gibt es also keine Absorption in das Gefäßsystem hinein, die Flüssigkeit muss exklusiv vom Lymphgefäßsystem abtransportiert werden. Durch die Aggrecan Aggregate in der Grundsubstanz des Interstitiums wird Flüssigkeit größtenteils zu Gel gebunden und liegt nicht als Sol vor. Dieser Vorgang wird bei einem Lymphödem vermehrt. Das Gel bindet immer mehr Wasser, weil der Abbau der Hyaloronsäure durch das initiale Lymphgefäßsystem/ Endothelzellen gestört ist.
Die Lymphe besteht aus Flüssigkeit (Wasserlast), Proteinen (Eiweißlast), nicht-mobilen Zellen (Zelllast), langkettigen Fettsäuren und Lipoproteine (Fettlast) sowie Fremdstoffen. Durch eine Ernährung mit mittelkettigen Fettsäuren kann das Lymphsystem entlastet werden. In Bezug auf die Wasserlast spielen die Lymphknoten eine sehr wichtige Rolle für die Resorption. Sie übernehmen den größten Teil der Flüssigkeit. Werden Lymphknoten bei einer Tumor-OP in einem anatomischen Bereich entfernt, wo initial wenige vorhanden sind, folgen Lymphödeme, weil die Resorption und der Abtransport verringert werden. Ist die Lymphlast höher als normal, kann das im normalen System kurzzeitig ausgeglichen werden. Bleibt die höhere Lymphlast bestehen, bricht die Lymphtransportkapazität ein oder wird weniger. Es kommt zum Ödem.
ICG Fluoreszenz-Methode zur Visualisierung des Lymphabflusses
Der Referent Dr. med. Thiha Aung der Universität Regensburg zeigte in einem Selbstversuch, wie durch die ICG Fluoreszenz-Methode der Lymphabfluss am Fuß, die Lymphknoten in der Kniekehle und Leiste sowie die Lymphbahnen entlang des Beins visualisiert werden können. Dabei zeigt die farbige Darstellung den freien Fluss, die Intensität einer Stauung oder eben die Transportkapazität. Diese Methode ist ideal für Patienten mit Melanomen. Außerdem kann ebenso eine Lymphdrainage unter ICG-Kontrolle gemacht werden, um den Effekt nachvollziehen zu können. Im Bereich der Hand wird sichtbar, dass die Lymphbahnen sehr nah an den Venen entlang fließen. Aber gerade am Arm zeigte sich auch, dass Lymphbahnen nicht nur gerade verlaufen, sondern um 90 Grad abknicken können. Mit der ICG Fluoreszenz-Methode ist eine Darstellung der unteren Extremitäten bis in den Axilarbereich möglich.
Lipödem und Psyche
Die Diplom-Psychologin Gabriele Erbacher der Földiklinik in Hinterzarten hat in einer großen Studie (G. Erbacher, T. Bartsch, Pilotstudie Földiklinik, 2020) mit 150 Patientinnen mit bestätigtem Lipödem festgestellt, dass sich die Psyche auf das Lipödem auswirkt und dass die psychische Situation entscheidend zu hohen Schmerzwerten beiträgt, diese aber auch wieder abschwächen kann. Die Psyche ist somit ein ganz wichtiger Ansatzpunkt bei der Behandlung des Lipödems und kann dabei helfen, dass aus großen Schmerzen wieder kleine werden. Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass bereits die ärztliche Information über die Pathosphysiologie der Lipödem-Schmerzen den Schmerzwert oft um 1-2 Punkte (VAS 0-10) senkt. Das heißt: Worte wirken und Ängste können durch gute Information verstärkt oder abgeschwächt werden. Daraus ist ein multimodaler Therapieansatz entstanden mit Physio-/Bewegungstherapie für eine verbesserte Fitness, kombiniert mit (entzündungssenkender) Kompression, Gewichtsmanagement (extrem wichtig, weil 80 % adipös sind), einer Liposuktion bei ausgewählten Patientinnen, Selbstmanagement und psychosozialer Therapie.
Lipödem und Lipohypertrophie
Dr. med. Axel Baumgartner macht seit 19 Jahren ausschließlich Liposuktion bei Lipödem. Als Chirurg in der Hanse-Klinik Lübeck sieht er für sich und seine Kollegen die Aufgabenstellung der Zeit: Die Differenzierung zwischen Lipödem, Lipohypertrophie und Adipositas! Denn die Diagnostik des Lipödems bleibt schwierig, sie kann nicht durch Laborwerte oder apparative Methoden gestützt werden. Für ihn haben sich vor allem zwei Punkte als besonders relevant erwiesen: die Disproportion und der Druckschmerz. Wobei auch er dem großen Paradigmenwechsel zustimmt und den Begriff des „Ödems“ hier als irreführend sieht, da keine interstitielle Flüssigkeit im Lipödem nachweisbar ist (Studie Hirsch et. al., Phlebologie 2018, 47. 182-187). Besser wäre eine neue Begrifflichkeit wie bspw. Lipohypertrophia dolorosa. In einer noch nicht vollständig veröffentlichten Studie haben Baumgartner, Hüppe und Schmeller die Langzeiteffekte der Liposuktion bei 112 Patientinnen über insgesamt neun Jahre untersucht. Sie ergab, dass vor der OP die Beeinträchtigungen stark und nach der OP gering waren. Nach vier bzw. acht Jahren waren sie leicht gestiegen aber gering geblieben. Sie konnten also einen positiven Langzeiteffekt nachweisen. Eine Liposuktion bringt zwar keine Heilung, aber es ist eine langfristige Verbesserung der Lebensqualität möglich.
Die Liposuktion: Die Therapie vorher und nachher sowie aktueller Stand der Studie
Auch für den niedergelassenen Phlebologen und Dermatologen Dr. med. Stefan Rapprich aus Bad Soden ist der Schmerz der zentrale Parameter für die Diagnose eines Lipödems. Er sieht die Liposuktion als eine wirksame Therapie, die aber stets in ein umfassendes Behandlungskonzept integriert sein sollte. Als Parameter für eine Liposuktion verweist er anstelle des BMIs, wie Dr. Baumgartner, auf die Körper-Indices (wie von Uli Herpertz 2020 vorgeschlagen): Bauchumfang-Größen-Quotient (BGQ) – sollte unter 60 % liegen und den Lipohyperthropie-Quotienten (LipQ) – der Oberschenkelumfang zur Körpergröße (ab 48 %). Beim Vergleich der beiden Liposuktionsmethoden PAL (Power Assistierte Liposuktion) und WAL (Wasserstrahl-assistiert Liposuktion) ordnet Dr. Rapprich die PAL-Methode als (Lymphgefäß) schonender ein, da durch die Vibrationskanülen und die Tumeszenz-Lokalanästhesie fast nur gelbes Aspirat abgesaugt wird. Das bedeutet, dass kaum bis gar keine Blutgefäße verletzt werden. Und direkt postoperativ ist der Behandlungserfolg an der natürlichen Form der Unterschenkel sichtbar. Eigene Studienergebnisse zeigen, dass bei 85 Patientinnen die Liposuktion in erster Linie eine Schmerztherapie ist. Es reduzierten sich ihre Schmerzen auf einer Skala von zu Beginn 8 (sehr stark) nach sechs Monaten postoperativ auf 2 (keine). Ebenfalls ging die Hämatomneigung zurück. Dazu gewinnen die Patientinnen ein neues Lebensgefühl und Selbstvertrauen. Sie beginnen Sport zu treiben und kleiden sich schöner, so dass die Gewichtsreduktion meist weitergeht.
Weitere Vorträge
Eva Streicher, Lymphzentrum Großhadern, München
Die physikalische Therapie des Lymphödems
Prof. Dr. Dr. med. Rüdiger G. H. Baumeister, München
Chirurgische Therapieoptionen beim Lymphödem:
Übersicht der Entwicklung bis heute
Dr. med. Anett Reißhauer, Charité Berlin